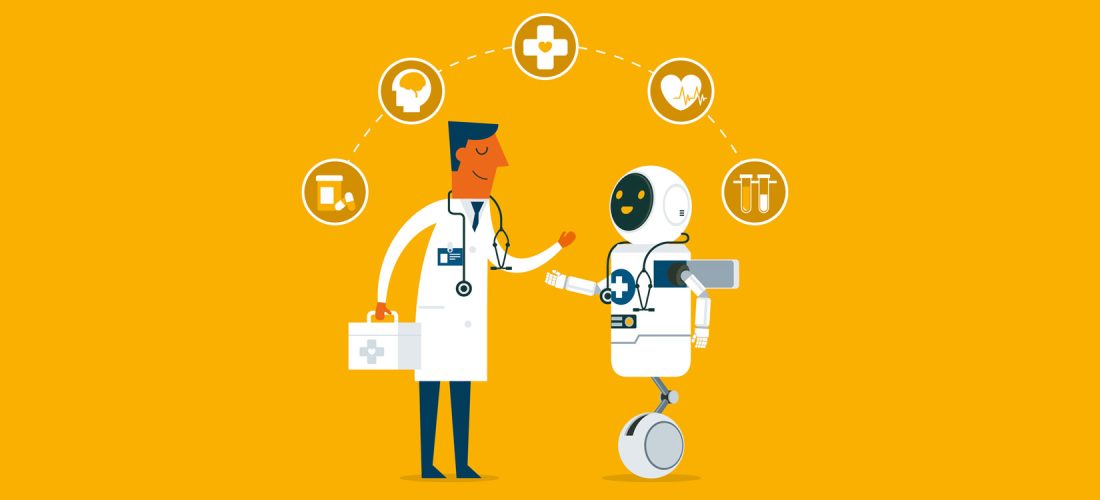Herr Gulyas, inwiefern wird künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt verändern?
Andreas Gulyas: In der jüngeren Vergangenheit betraf die Digitalisierung vor allem Berufe, in denen körperlich gearbeitet wird, etwa wenn es darum geht, dass Industrieroboter die menschliche Arbeitskraft ersetzen. Durch künstliche Intelligenz trifft der technologische Wandel mit Textverarbeitungsprogrammen wie ChatGPT nun in erster Linie Büroberufe oder Jobs, in denen geistiges Wissen gefragt ist.
Wird KI dadurch helfen, den Fachkräftemangel zu beheben? Einer aktuellen Studie zufolge gab es noch nie so viele offene Stellen in IT-Berufen wie im vergangenen Jahr.
Die Firmen werden die technologische Entwicklung der künstlichen Intelligenz ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend vorantreiben und sicherlich speziell da, wo ein Mangel an Personal herrscht. Grundsätzlich ist sicherlich außerdem davon auszugehen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die KI-Innovationen produktiver werden. Muss ein börsennotiertes Unternehmen etwa einen hundertseitigen Jahresbericht erstellen, kann eine KI die Vorarbeit leisten, und wenige Sachverständige editieren den Text. Insofern wird eine erhöhte Produktivität durch KI vermutlich schon helfen, den Fachkräftemangel ein Stück weit abzufedern.

Andreas Gulyas promovierte 2017 an der University of California, Los Angeles in Wirtschaftswissenschaften und ist inzwischen Juniorprofessor an der Universität Mannheim. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Arbeitsmärkte, wie z.B. die Auswirkungen von Transparenz auf Arbeitsmärkte, langfristige Auswirkungen von Arbeitsplatzverlagerungen und Einstellungs- und Trennungsentscheidungen von Unternehmen.
Das World Economic Forum erwartet, dass etwas mehr als jeder zehnte Job weltweit binnen fünf Jahren von KI übernommen wird, also etwa 80 Millionen Jobs. Viele haben da sicherlich auch Angst, ihren Beruf zu verlieren.
Das ist verständlich. Aber in einem Zeitalter, in dem überall händeringend nach Fachkräften gesucht wird, ist ein technologischer Umbruch leichter zu bewerkstelligen als in Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist wie noch etwa vor 20 Jahren.
Gehen Sie denn davon aus, dass manche Berufe komplett verschwinden werden?
Als etwa das Auto erfunden wurde, kam eine ganze Branche von Kutschern und Hufeisenschmieden weitgehend zum Erliegen. Gleichzeitig bringt das Auto bis heute eine Vielzahl neuer Berufsmöglichkeiten mit sich. Heißt: Technischer Fortschritt gilt immer ein Stück weit als Treiber für zusätzliche Arbeitsplätze. Ob manche Berufe komplett verschwinden werden, bleibt abzuwarten. Sicherlich entstehen aber neue Arbeitsfelder und Berufsbezeichnungen.
Was ist aus Ihrer Sicht wichtig als Vorbereitung auf diesen Wandel?
In der gegenwärtigen Situation würde ich sagen, dass Deutschland aufpassen muss, nicht abgehängt zu werden. Denn der Einsatz von und die Forschung zu KI ist stark von Amerika dominiert. Entsprechend gilt es, in digitale Arbeitsplätze zu investieren und in Bildung, sodass künftige Generationen ermächtigt werden, mit digitalen Tools und Künstlicher Intelligenz umzugehen. Es wäre wünschenswert, dass Kinder bereits in den Skills ausbildet werden, die komplementär zur KI sind, also in Fähigkeiten, in denen die KI eben nicht gut ist und es wohl auch niemals sein wird.
Kreativität und Empathie zum Beispiel?
Ja. Und natürlich sollte es auch darum gehen zu verstehen, wie die Algorithmen funktionieren. Wenn die KI wirklich so erfolgreich sein wird wie alle vorhersagen, dann werden natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer am erfolgreichsten sein, die die KI mitentwickeln. Aber obwohl Informatik ein wichtiger Zukunftsbereich ist, gehört Programmieren bislang nicht zum Curriculum an Schulen. Da könnte man sich schon fragen, ob man an den Schulen die Fächer nicht in der Form umgestaltet oder umschichtet, dass sie die Kinder und Jugendlichen in den Fähigkeiten unterrichten, die sie brauchen, um in der modernen, digitalisierten Wirtschaft mitzuhalten. Aber ohne Zuwanderung wird es sicherlich auch zukünftig nicht gehen.
Wie schätzen Sie die Rolle der Immigration im Hinblick auf die Bewältigung des Fachkräftemangels ein?
Es wird sehr schwer, ihn auszugleichen, wenn sich Deutschland der Zuwanderung gegenüber verschließt. Und wenn wir Menschen anziehen wollen, die bereits über gute Skills verfügen und die wirklich dringend gebraucht werden, dann muss es in Deutschland eine Atmosphäre geben, in der die Gesellschaft der Immigration positiv gegenübersteht. Eine Atmosphäre, in der sich Menschen aus anderen Kulturen willkommen geheißen fühlen.