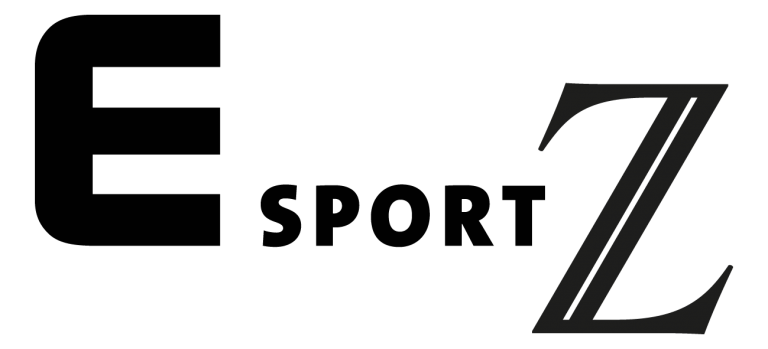Herr Prof. Leissler, was unterscheidet ein gutes Videospiel von einem schlechten?
Für die meisten Kinder und Jugendlichen sind Videospiele Erlebniswelten, in die sie genauso selbstverständlich eintauchen wie in Aktivitäten in der analogen Welt – ins Tennisspiel oder das Fahrradfahren etwa. Im besten Fall besteht zwischen beiden Welten ein Austausch. Das heißt: Ich nutze meine Fähigkeiten und mein Wissen aus der analogen Welt in der Welt des digitalen Spiels. Genauso profitiere ich umgekehrt von den Skills, die ich im Spiel erworben habe. Je mehr Austausch stattfindet, desto höherwertiger ist aus meiner Sicht ein Spiel. Die zentrale Frage dabei lautet: Welche Strategien im Lösen von Problemen eigne ich mir in einer der beiden Welten an? Und wie kann der Transfer von der einen in die andere Welt gelingen?
Zum Beispiel?
Ein negatives Beispiel ist für mich „Fortnite“. Das Spiel funktioniert, vereinfacht ausgedrückt, so, dass ungefähr einhundert Spieler im virtuellen Raum gegeneinander antreten. Sie bekriegen sich, und am Ende verlässt einer als Sieger das Feld. Dass es dabei ziemlich rabiat zugeht, ist gar nicht mal der Punkt. Sondern vielmehr die Problemlösestrategie. Sie lautet: Wie werde ich die anderen los? Das ist heutzutage ein unrealistisches Problem mit einer unrealistischen Lösung, und wer sich im echten Leben so verhält, wird es vermutlich nicht weit bringen.
Ein positives Beispiel ist hingegen „Splatoon 2“. Bei „Splatoon 2“ laufen die Spieler mit einer Farbpistole durch eine Arena und müssen den Boden mit möglichst viel eigener Farbe bedecken, und zwar im Team in zwei gegnerischen Mannschaften. Diejenigen gewinnen, die am meisten Fläche markiert haben. Abstrahiert betrachtet ist die Problemlösestrategie hier, wie ich mit meinem Team so zusammenarbeiten kann, dass wir die meiste Fläche mit der eigenen Farbe besetzen. Die Farbe steht metaphorisch für Probleme in der realen Welt. Zum Beispiel wie ich in einer Firma oder in einem Team einen Marktanteil mit einer Marke erobere. Oder vielleicht die Frage, wie ich den eigenen Einfluss in den Social Media ausweiten kann. Meine Problemlösestrategien, die ich hier erwerbe, kann ich sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt anwenden.

Martin Leissler ist mit dem Super Nintendo Entertainment System im Kinderzimmer aufgewachsen und hat sein Taschengeld in Arcade-Automaten versenkt. Schon in Schulzeiten arbeitete er an der Programmierung von Videospielen. Nach einem Studium und der Promotion im Fach Informatik arbeitet er heute als Professor im Fachbereich Media, Lehrgebiet Game Development, an der Hochschule Darmstadt und bringt Studierenden bei, Spiele zu entwickeln, die nicht nur Spaß machen, sondern auch die Motivation, den Teamgeist und die Ausdauer der Spielenden stärken.
Wie könnte man ein solches Spiel im Schulunterricht nutzen?
Zunächst könnte man die Kinder analysieren lassen, welche Strategien überhaupt angewendet werden, da diese ja zumeist unbewusst zum Einsatz kommen. Dann ließen sich den beiden Teams verschiedene Strategien zuordnen. Was geschieht, wenn unterschiedliche Strategien aufeinandertreffen? Welche Strategie funktioniert besser? Gewinnen wenige, während viele auf der Strecke bleiben? Und warum ist das so? Das ist letztlich nichts anderes als praktizierte Spieltheorie – und zudem eine wertvolle Erfahrung fürs Leben. In der Wirklichkeit kann es schließlich Jahre dauern, bis ich mal in eine Situation gerate, in der solche Strategien wichtig sind. Dann könnten sich solche unbewusst angeeigneten Problemlösemuster auszahlen.
Welche weiteren Fähigkeiten vermitteln die E-Sport-Games?
Zum einen helfen sie, sich zu fokussieren. Die Aufmerksamkeitsspannen sind bei vielen Kindern und Jugendlichen durch das Hin-und-her-Springen zwischen verschiedenen Medien doch recht kurz. Spiele können hier die Bereitschaft fördern, konsequent an einer Sache zu bleiben. Denn im Teamplay muss man sich aufeinander verlassen können. Steige ich vorher aus, bekomme ich kein Ergebnis und ziehe alle anderen mit in den Abgrund. Ganz nebenbei lernt man darüber hinaus Sprachen, weil viele Spiele auf Englisch gespielt werden. Meine Kinder zum Beispiel haben ihr Schulenglisch dadurch deutlich verbessert.
Onlinespiele gelten immer wieder als Einfallstore für Übergriffe aus dem Internet auf Kinder und Jugendliche. Wie lässt sich dieser Gefahr begegnen?
In die Spiele sind Mechanismen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen integriert, eine kontrollierte Kommunikation in Chats beispielsweise. Hier wird innerhalb des Gesprächsprotokolls nach bestimmten Schlagworten gesucht – das müssen Entwickler von Video- und Computerspielen genauso leisten wie die Betreiber von Social-Media-Plattformen. Ich glaube aber, dass ein echter und nachhaltiger Schutz nur dadurch zustande kommt, dass die Erwachsenen sich selbst mit den Medien beschäftigen und wissen, wo Gefahren lauern. So können sie ihre Kinder sensibilisieren und ihnen eine entsprechende Kompetenz vermitteln.
Die Eltern und Lehrer müssen also selbst spielen?
Ja. Kinder und digitale Spiele sich selbst zu überlassen wäre so ähnlich, als wenn ich im Baumarkt ein paar Werkzeuge kaufe – darunter eine Kettensäge –, sie ins Kinderzimmer lege und sage: Damit werden die Kinder schon irgendwie umzugehen lernen. Das funktioniert nicht, und in anderen Zusammenhängen ist das auch völlig klar.
Natürlich: Die Beschäftigung mit den Spielen kostet Zeit, und die fehlt dann vielleicht an anderer Stelle. Aber alles andere wäre russisches Roulette mit unserer Jugend. Und: Die Kids merken, ob man sich das Wissen über die Spiele nur theoretisch angeeignet hat. Das fällt mir in meinen Lehrveranstaltungen immer wieder auf.
Um den Anschluss an aktuelle Games nicht zu verpassen und authentisch zu bleiben, habe ich mir im vorletzten Semester auferlegt, vier Stunden in der Woche zu spielen. Vier Stunden reichen nicht, um die Spiele komplett zu durchdringen. Aber diese Zeit reicht, um zu verstehen, was gut an einem Spiel ist oder eben nicht. Diese Zeit musste ich in meinem Kalender genauso blocken wie andere wichtige Termine.
Wie können Lehrkräfte, die bislang kaum über eigene Spiele-Erfahrungen verfügen, sich dem E-Sport oder auch digitalen Spielen annähern?
Zum einen durch Ausprobieren. Hilfreich ist sicher auch der Austausch mit erfahrenen Kollegen. Außerdem gibt es in Deutschland bis zu 20 Studiengänge, die mit dem Thema „Digitale Spiele“ zu tun haben. Ich bin überzeugt, dass viele Professorinnen und Professoren einer Einladung an eine Schule folgen und konkrete Tipps geben würden. Genauso wichtig: die Schülerinnen und Schüler mit einzubinden und sie nach ihren persönlichen Erfahrungen und Vorlieben zu fragen.
Welches Spiel mögen Sie selbst am liebsten?
Es ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber eines meiner Lieblingsspiele ist „Mario Kart“. Und zwar deshalb, weil ich die virtuellen Autorennen mit meinen drei Kindern und meiner Frau zusammen spiele. Das ist wirklich so ein Familiending – vergleichbar mit einem Fernsehabend. Dafür kann ich sogar meine 16-jährige Tochter begeistern. Meine beiden Jungs sind eh mit von der Partie.